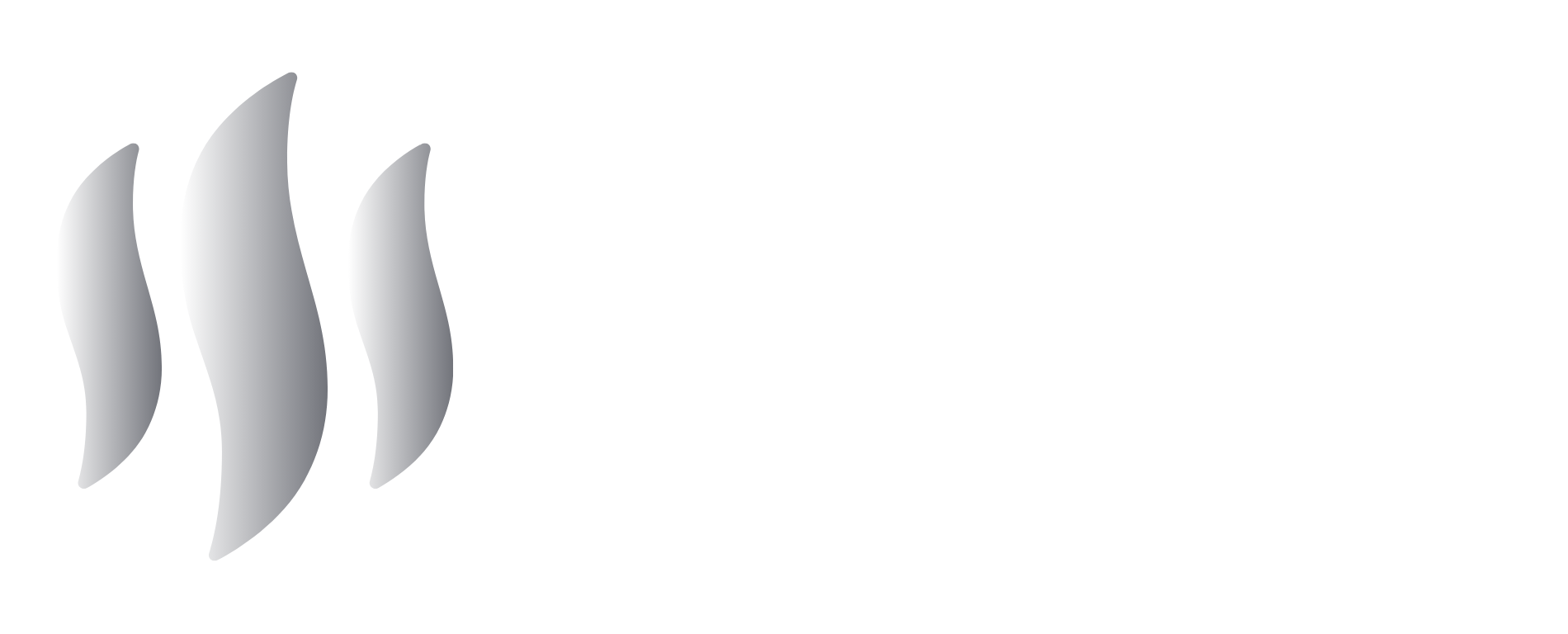Der Energieverbrauch verschiedener Wärmepumpen wird im Leistungskoeffizienten (COP) angegeben. Unabhängig vom Typ, ob Luft- oder Erdwärmepumpe, wird die Effizienz anhand des COP gemessen. Doch was bedeutet dieser COP eigentlich?
Wärmepumpen werden oft fälschlicherweise nur anhand eines COP-Werts beurteilt. Ein hoher COP-Wert bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Wärmepumpe wirtschaftlich ist. Für einen fairen Vergleich spielt der integrierte Wert (SCOP) eine entscheidende Rolle. Es ist auch wichtig zu verstehen, wie sich die Wärmepumpe im Teillastbereich verhält.
Ursprung der Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe entzieht Wasser oder Luft Wärme. Je nach Wärmequelle unterscheidet man zwischen verschiedenen Systemen. Als Wärmequelle eignet sich nahezu jedes wärmespeichernde Medium (ob solar gewonnen oder nicht), beispielsweise Erdwärme, Oberflächenwasser, Außenluft, Lüftungsluft oder Abwärme aus industriellen Prozessen. Die Wärme wird aufbereitet und an Luft oder Wasser abgegeben, um sie zur Raumheizung oder zur Warmwasserbereitung zu nutzen. Für den Start und die Aufrechterhaltung dieses Prozesses wird Strom benötigt. 
Was bedeutet der COP einer Wärmepumpe?
Der COP ist das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmemenge und dem Stromverbrauch (Leistungsaufnahme) der Wärmepumpe. Dies lässt sich am besten anhand eines Beispiels erklären.
Beispiel: Pro 5 kWh Wärme, die eine Wärmepumpe erzeugt, stammen 4 kWh aus der Quelle (Luft oder Wasser) und 1 kWh aus Strom. Anders ausgedrückt: Pro 5 kWh Wärme setzt sich der COP in diesem Beispiel aus 4 kWh Wärme aus der Quelle und 1 kWh Strom zusammen. Der COP beträgt hier also 5. Berechnet sieht das so aus: 
Ein höherer COP bedeutet einen geringeren Stromverbrauch und einen sparsameren Betrieb der Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe mit hohem COP hat eine kürzere Amortisationszeit und benötigt weniger Solarmodule, um den Verbrauch auszugleichen. Dies macht den COP zu einem relevanten Wert. 
Effizienz einer Wärmepumpe
Im oben genannten Beispiel liegt der COP bei 5, wobei nur 1 Teil Strom für 5 Teile Wärme benötigt wird. Dies ergibt einen Wirkungsgrad von 500 %, was im Heizsektor außergewöhnlich ist. Zum Vergleich: Nachfolgend sind die Wirkungsgrade einer Elektroheizung und eines Zentralheizungskessels aufgeführt.
COP und Effizienz von elektrischen Zentralheizungskesseln oder elektrischen Heizkörpern
Bei vollelektrischen Heizungen, wie beispielsweise einem elektrischen Zentralheizungskessel oder einem elektrischen Heizkörper, ist der Wirkungsgrad nicht so hoch. Im besten Fall erzeugt eine vollelektrische Heizung pro verbrauchter kWh Strom 1 kWh Wärme. Dies berechnet sich wie folgt:

Der COP liegt dann bei 1 und der Wirkungsgrad bei 100 %. Der Energieeinsatz entspricht dem Energieertrag. Noch wichtiger ist, dass eine Wärmepumpe fünfmal sparsamer mit Strom umgeht als ein Elektroheizer, möglicherweise weil sie Wärme aus einer Quelle entzieht und auf ein nutzbares Niveau aufbereitet. Der Großteil der Energie stammt nicht aus Strom, sondern aus der Wärme von Luft oder Wasser.
COP und Effizienz eines Gaskessels
Ein gasbetriebener Zentralheizungskessel ist mit Verlusten konfrontiert. Die bei der Gasverbrennung freigesetzte Wärme kann nicht vollständig auf das zu erhitzende Wasser übertragen werden, was zu Wärmeverlusten und einem Effizienzverlust führt. Außerdem entsteht beim Erhitzen von Wasser im Zentralheizungskessel Wasserdampf, der zusammen mit den Rauchgasen aus dem Schornstein entweicht. Bei einem HR-Kessel wird der Wasserdampf kondensiert, was zu geringeren Verlusten und einer höheren Effizienz führt. Trotzdem kann die Effizienz nie 100 % oder mehr erreichen. Die durchschnittliche Effizienz eines Zentralheizungskessels liegt bei etwa 90 %, was einem COP von 0,9 entspricht. Das ist mehr als fünfmal weniger effizient als eine Wärmepumpe. Einige Kesselhersteller geben eine Effizienz von bis zu 107 % an, diese Behauptung wird jedoch auf der folgenden Website bestritten: https://cvketelkiezen.nl .
Der COP einer Wärmepumpe ist kein fester Wert
Der COP einer Wärmepumpe hängt von mehreren Faktoren ab:
- Zunächst spielt die Effizienz der Wärmepumpe selbst eine Rolle. Je effizienter die Wärmepumpe Warmwasser oder Luft erzeugt, desto höher ist der COP. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz von Inverterkompressoren und elektronisch gesteuerten Expansionsventilen.
- Darüber hinaus beeinflusst die Temperatur der Quelle (Luft oder Wasser) den COP, ebenso wie die Temperatur des erzeugten Wassers/der erzeugten Luft. Je höher die erzeugte Temperatur, desto höher der Verbrauch und desto niedriger der COP. Das ist sinnvoll, denn es benötigt mehr Energie, Wasser von 15 °C auf 80 °C zu erhitzen als von 15 °C auf 35 °C.
COP einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der sonnenerwärmten Außenluft selbst bei Frost Wärme. Diese Wärme wird auf ein nutzbares Niveau gebracht und an Wasser abgegeben, das zur Raumheizung (Fußbodenheizung, Heizkörper) und/oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
Diese Wärmepumpe besteht (fast) immer aus einem Außengerät und einem Innengerät. Das Außengerät befindet sich im Freien, saugt Luft an und bläst diese kälter wieder aus. Der Temperaturunterschied zwischen beiden ist die aufgenommene Wärme der Wärmepumpe.
Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen- und Außeneinheit
Man kann sich vorstellen, dass die Wärmepumpe bei kälteren Außentemperaturen mehr arbeiten muss, um Wasser zu erwärmen, als bei wärmeren Temperaturen. Schließlich muss ein größerer Unterschied überbrückt werden. Das bedeutet auch, dass der COP bei unterschiedlichen Außentemperaturen schwankt. Je kälter es draußen ist, desto niedriger ist der COP bei gleicher Ausgangstemperatur.
Das bedeutet, dass der COP einer Luftwärmepumpe wetterabhängig ist. Aber auch von der Jahreszeit und dem Standort. Im Winter ist es kälter als im Sommer und die Wärmepumpe muss härter arbeiten. Dasselbe gilt für Skandinavien, wo es draußen kälter ist als in den Niederlanden.
Eine Luftwärmepumpe hat daher nie nur einen COP (siehe Grafik unten). Die linke Achse zeigt zwei Werte: den COP und die Außenlufttemperatur. Die untere Achse zeigt die Temperatur des erzeugten Wassers.

SCOP-Wärmepumpe
Aber was ist der SCOP einer Wärmepumpe? Die Abkürzung steht für Seasonal Coefficient of Performance (saisonale Leistungszahl) . Tatsächlich handelt es sich dabei um nichts anderes als einen durchschnittlichen COP über ein Jahr, wobei die Jahreszeiten in einer bestimmten Region berücksichtigt werden.
Der SCOP erleichtert den Vergleich von Wärmepumpen untereinander, insbesondere von Luftwärmepumpen, bei denen die Jahreszeiten einen Einfluss auf die Effizienz haben. Bei kälteren Temperaturen muss eine Wärmepumpe mehr arbeiten und der COP sinkt, wie oben beschrieben.
Um den SCOP einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zu berechnen, wird der Durchschnitt aller COP-Werte in einer bestimmten Region, beispielsweise der Region Utrecht (oder einem anderen Teil Europas), für ein ganzes Jahr ermittelt. Dies geschieht dann bei verschiedenen Ausgangstemperaturen in Schritten von 5 °C. So wissen Sie, wie hoch der SCOP für diese Wärmepumpe bei der Erzeugung von 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C usw. ist.
Der SCOP einer Wärmepumpe ist in Skandinavien niedriger als in Spanien, da es dort kälter ist. Auch das Wärmeübertragungssystem, wie Heizkörper oder Fußbodenheizung, kann den SCOP beeinflussen. Mehr dazu im nächsten Kapitel.
Bei modernen Luftwärmepumpen in den Niederlanden beträgt der SCOP ungefähr 5,2 bei einer Austrittstemperatur von 35 °C.

COP und SCOP – Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Das Wärmeabgabesystem, wie Heizkörper oder Fußbodenheizung, beeinflusst tatsächlich den COP und SCOP. Diese Werte hängen von der Temperatur des erzeugten Wassers ab.
Ein herkömmlicher Heizkörper ist ein sogenannter Hochtemperaturheizer. Damit Heizkörper einwandfrei funktionieren, muss das durchfließende Wasser eine Temperatur zwischen 60 °C und 80 °C haben. Der Heizkörper übernimmt die Wassertemperatur, und erst ab dieser Temperatur entsteht Konvektion. Das bedeutet, dass die Luft im Raum aufsteigt und zirkuliert, sodass die Luft stets am Heizkörper vorbeiströmt und den gesamten Raum mit Wärme versorgt. Geschieht dies nicht, entsteht lediglich Strahlungswärme.
Fußbodenheizungen sind sogenannte Niedertemperaturheizungen. Da die beheizte Oberfläche deutlich größer ist als bei Heizkörpern, wird der Raum gleichmäßiger erwärmt. Die Temperatur des durch die Fußbodenheizung fließenden Wassers liegt zwischen 20 und 35 °C und ist damit deutlich niedriger als bei Heizkörpern. Eine gute Isolierung ist Voraussetzung für Niedertemperaturheizungen.
COP für Fußbodenheizung niedriger
Da das Wasser bei einer Fußbodenheizung nicht so stark erhitzt werden muss, kann die Wärmepumpe weniger arbeiten. Dies führt zu höheren COP- und SCOP-Werten. Eine Niedertemperaturheizung ist daher empfehlenswert, da die Wärmepumpe dann weniger Strom verbraucht. Es gibt übrigens auch Niedertemperaturheizkörper. Darüber hinaus können herkömmliche Heizkörper (bei entsprechender Dicke) mit einem Climatebooster ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um Propeller unter den Heizkörpern, mit denen die Ausgangstemperatur um bis zu 15 °C gesenkt werden kann. Die Rohrleitungen müssen dann einen ausreichend großen Durchmesser haben, um die benötigte größere Wassermenge transportieren zu können.
Wärmepumpen miteinander vergleichen
In Europa ist die Messmethode zur Berechnung des COP als Standard NEN14511 und NEN14825 bei Eurovent etabliert. Dies ermöglicht den Vergleich von Wärmepumpen. Dennoch ist es möglich, dass der COP kein vollständiges Bild liefert.
Wenn der Spitzenlastwert (Maximalwert) der Wärmepumpe angegeben ist, handelt es sich dabei um die maximale Leistung, die geliefert werden kann, ohne Abzüge für die Bedingungen, unter denen die Wärmepumpe betrieben wird.
Der integrierte Wert (integrierter oder gewichteter Wert) berücksichtigt unter anderem den Wärmeverlust beim Abtauen der Luftwärmepumpe. Dies sind tatsächliche Praxiswerte und geben die tatsächlich abgegebene Leistung unter bestimmten Bedingungen an. Das Außengerät der Wärmepumpe kann einfrieren, insbesondere bei Außentemperaturen zwischen -2 und 5 °C. Gelegentlich wird der Heizvorgang automatisch umgekehrt, um das Außengerät abzutauen.
Damit gibt der integrierte Wert ein deutlich ehrlicheres Bild vom tatsächlichen Verbrauch einer Wärmepumpe wieder. Nicht jeder Hersteller gibt diesen Wert an.
Teillast und Volllast
Angenommen, Sie hätten die Wahl zwischen zwei Wärmepumpen. Die erste schneidet bei -10 °C (Volllast) in Bezug auf den COP besser ab, bei 7 °C (Teillast) jedoch schlechter. Die zweite schneidet bei der COP genau umgekehrt ab: Sie ist bei -10 °C schlechter, bei 7 °C jedoch besser. Welche würden Sie wählen?
Wir empfehlen Ihnen die Wärmepumpe mit dem besten Wirkungsgrad bei der am häufigsten auftretenden Temperatur. In den Niederlanden ist dies die zweitgrößte Wärmepumpe.
Die erste Wärmepumpe ist schwerer, um bei niedrigeren Außentemperaturen und Volllast eine bessere Effizienz zu erreichen. Bei Teillast sind jedoch die schwereren Komponenten im Weg (denken Sie an eine größere Pumpe/einen größeren Lüfter), weshalb diese Wärmepumpe mehr verbraucht.
Deshalb kommt man mit einer etwas zu kleinen Wärmepumpe oft besser zurecht als mit einer zu großen. Erstens ist der Verbrauch in den meisten Fällen geringer, was sie letztendlich zur sparsamsten macht. Auch der Anschaffungspreis ist niedriger. Ein etwas niedrigerer COP bei Volllast (starker Frost) muss man in Kauf nehmen. Bei außergewöhnlicher Kälte und einer kleinen Wärmepumpe kann ein elektrisches Reserveelement eingesetzt werden, das nur dann ausreichend Wärme liefert. Ja, der Stromverbrauch ist dann kurzzeitig höher. Und ja, die restliche Zeit ist der Stromverbrauch deutlich niedriger.
COP Leitungswasser
In fast allen Fällen unterscheidet sich der COP von Leitungswasser vom COP der Raumheizung. Dies hängt mit dem Temperaturunterschied zwischen beiden zusammen.
Das Erhitzen von Wasser mit einer Wärmepumpe dauert länger als mit einem Zentralheizungskessel (da dieser oft eine geringere Leistung hat). Um zu verhindern, dass Sie unter einer kalten Dusche stehen, wird ein Warmwasservorrat angelegt. Die Wassertemperatur im Pufferspeicher beträgt üblicherweise 55 °C. Gelegentlich wird das Wasser im Pufferspeicher zusätzlich erwärmt, um Legionellenbildung vorzubeugen.
Das Heizwasser für die Fußbodenheizung hat eine Temperatur von 35 °C und ist damit weniger warm als das Leitungswasser. In diesem Fall ist der COP des Leitungswassers niedriger als der des Wassers für die Fußbodenheizung.
Bei Hochtemperaturheizungen ist der COP des Leitungswassers tatsächlich höher als der des Wassers für die Heizkörper, das eine Wassertemperatur zwischen 60 und 80 °C benötigt.

COP Erdwärmepumpe
Mit einer Erdwärmepumpe wird Wärme aus Wasser gewonnen. Die Wärmequelle kann das Erdreich, Oberflächenwasser oder eine unterirdische Wasserquelle sein. Deshalb spricht man oft von Erdwärmepumpe, Erdwärmepumpe oder Erdwärme. Diese Begriffe sind identisch.
Wenn die Wärmequelle im Erdreich liegt, verläuft ein geschlossener Rohrkreislauf mit einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel durch das Erdreich. Das Wassergemisch übernimmt die Temperatur der Quelle. Das erwärmte Wassergemisch wird dann an der Wärmepumpe vorbeigepumpt, die ihm Wärme entzieht und die Temperatur auf ein nutzbares Niveau anhebt. Das kältere Rücklaufwasser wird zurück in die Quelle gepumpt, dort wieder erwärmt und der Kreis schließt sich. Dies funktioniert bei unterirdischen Wasserquellen genauso wie bei Oberflächenwasser. Alternativ kann eine offene Quelle genutzt werden. In diesem Fall gibt es eine offene Zulauf- und Rücklaufleitung.
Die Temperatur einer Erdwärmequelle ist konstanter als die der Außenluft. Dadurch gibt es bei einer Erdwärmepumpe weniger jahreszeitliche Schwankungen als bei einer Luftwärmepumpe. Der SCOP spielt daher bei einer Erdwärmepumpe keine Rolle. Eine Erdwärmepumpe hat in der Regel einen um 0,5 bis 1 COP-Punkt höheren COP-Wert als eine Luftwärmepumpe. Bei höheren Außentemperaturen ist die Luftwärmepumpe sogar im Vorteil.
Luftwärmepumpe oder Erdwärmepumpe?
Betrachtet man diese Unterschiede aus der Perspektive, ergibt sich folgendes Bild. Der durchschnittliche jährliche Gasverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts beträgt etwa 1600 m³. Davon werden durchschnittlich 400 m³ für Warmwasser und 1200 m³ für die Heizung verwendet. In modernen, besser isolierten Häusern, die strengere EPC-Anforderungen erfüllen, beträgt der durchschnittliche Verbrauch 800 m³ Gas pro Jahr. In diesem Fall werden weiterhin 400 m³ für die Warmwasserbereitung und nur 400 m³ für die Heizung verwendet. Bei geringerem Energieverbrauch lassen sich mit einer Wärmepumpe daher weniger Einsparungen erzielen. Das bedeutet, dass es in einem modernen Haus weniger möglich ist, einen COP-Punkt zurückzugewinnen.
Vor etwa zehn Jahren waren die COPs von Luft-/Wasser-Wärmepumpen nicht so effizient wie heute und lagen daher deutlich unter denen von Erdwärmepumpen. Durch den intelligenten Einsatz von Inverterkompressoren und elektronischen Expansionsventilen ist der Wirkungsgrad heute nahezu mit dem von Erdwärmepumpen vergleichbar. Bei -10 °C ist nun ausreichend Heizleistung vorhanden, was früher nicht immer der Fall war.
Finanziell ist eine Erdwärmepumpe aufgrund der erforderlichen Quelleninstallation 3.000 bis 5.000 € teurer als eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die Einsparungen mit einer Erdwärmepumpe im Vergleich zu einer Luftwärmepumpe betragen dank eines etwas besseren COP durchschnittlich 60 € pro Jahr. Die Amortisationszeit ist daher unrealistisch lang; es dauert mindestens 50 Jahre (3000/60 = 50 Jahre), bis sich die Investition in eine Erdwärmepumpe im Vergleich zu einer Luftwärmepumpe amortisiert hat. Eine bessere Alternative ist es, das Geld nicht in Erde zu investieren, sondern auf dem Dach zu installieren. Indem Sie den gleichen Betrag in Solarmodule investieren, können Sie den Verbrauch der Luft/Wasser-Wärmepumpe kompensieren und kostenlos heizen und kühlen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite über Luftwärmepumpen oder Erdwärmepumpen.
Durchbruch beim COP gegenüber dem Gaskessel
Eine Wärmepumpe wird mit Strom betrieben (Kosten für Privatpersonen oder Kleinverbraucher: 1 kWh, 0,214 €), während ein Heizkessel mit Gas betrieben wird (1 m3, 0,66 €). In diesem Fall vergleichen wir tatsächlich Äpfel mit Birnen. Um einen fairen Vergleich zu ermöglichen, haben wir berechnet, dass ein Kubikmeter (m3) Gas 9,7 kWh Energie enthält. So können wir den Preisunterschied bestimmen. Strom kostet derzeit 0,214 € pro kWh, während Gas 0,66 € / 9,77 = 0,068 € pro kWh kostet. Gas ist also deutlich günstiger als Strom! Trotzdem verbraucht eine Wärmepumpe viel weniger Strom als ein gasbetriebener Heizkessel. Die Frage ist nun: Wie hoch muss der COP sein, um günstiger als Gas zu sein?

Liegt der COP-Wert über 2,83, ist eine Wärmepumpe günstiger als ein Gaskessel. Mit einem SCOP von 5,2 bei einer Austrittstemperatur von 35 °C ist dieses Ziel problemlos erreichbar. Dies führt tatsächlich zu erheblichen Einsparungen mit einer Wärmepumpe. Mit Solarmodulen erzeugen Sie den für die Wärmepumpe benötigten Strom selbst, was sich natürlich auf die Amortisationszeit auswirkt, insbesondere bei hohem Gasverbrauch.

Finanzielles Sparen Nachhaltiges Fazit
Der COP gibt Aufschluss über den Verbrauch einer Wärmepumpe. Je höher die Zahl, desto weniger Strom verbraucht die Wärmepumpe. Der COP kann jedoch insbesondere bei einer Luftwärmepumpe ein verzerrtes Bild vermitteln, da die Umstände entscheidend sind. Ein SCOP ist daher genauer, da er einen gewichteten Durchschnitt über ein ganzes Jahr darstellt. Wenn der SCOP als integrierter Wert ausgedrückt wird, werden alle Variablen einbezogen, und das Ergebnis ist am wahrsten. Obwohl Gas pro kWh günstiger ist als Strom, erweist sich eine Wärmepumpe aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit als sparsamer im Verbrauch. Die besseren Wärmepumpen haben einen SCOP von 5,2.